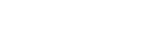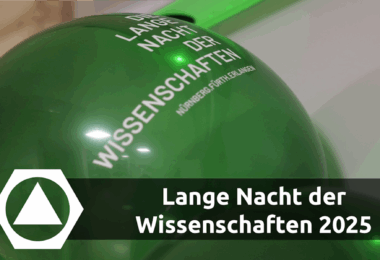28 Years Later überrascht als stilvoller Coming-of-Age-Zombie-Film mit Tiefgang, starken Bildern und einem völlig neuen Zugang zum Genre – fernab vom üblichen Gemetzel.

Ich muss gestehen: Als ich von 28 Years Later das erste Mal hörte, war meine Erwartungshaltung recht niedrig. Alles daran roch zunächst nach einem uninspirierten Cashgrab – ein letzer Versuch, aus der britischen Zombieklassiker-Reihe noch etwas Profit zu schlagen. Spätfortsetzungen, gerade wenn der Vorgänger fast zwei Jahrzehnte zurückliegt, haben sich in den letzten Jahren leider allzu oft als fragwürdige Methode erwiesen, hochgeschätzte Franchises endgültig zu Grabe zu tragen – auch wenn sie selten wirklich tot zu bleiben scheinen. Konkret kommen einem dabei Beispiele wie der Verfall der Indiana Jones Reihe oder die peinliche Fortsetzung der Matrix-Trilogie in den Sinn. Dennoch erhoffte ich mir beim Kinobesuch von 28 Years Later zumindest ein unterhaltsames Zombie-Gemetzel und vielleicht sogar eine kreative Neuerfindung einer Welt, die nunmehr seit knapp dreißig Jahren vom sogenannten RAGE-Virus heimgesucht wird, das seine Opfer in wutentbrannte Wilde verwandelt. Kurze Warnung vorweg: Die Rezension ist größtenteils spoilerfrei, einen ausführlichen Überblick über die wesentlichen Punkte der Handlung gibt es aber dennoch.
Coming of Age statt Zombie-Massaker
Der zwölfjährige Spike, gespielt von Alfie Williams, wächst in einer Welt auf, in der die ständige Bedrohung durch die wildgewordenen Infizierten und der Überlebenskampf der letzten Überbleibsel der Zivilisation längst zum Alltag geworden sind. Als eine Art Initiationsritus macht er sich gemeinsam mit seinem Vater Jamie (Aaron Taylor-Johnson) auf den Weg, um seinen ersten Infizierten zu erlegen. Während hier kaum überraschend einiges schief läuft, erfährt Spike, dass es zu seiner Verwunderung einen echten Arzt in der Nähe geben soll, der in der Lage sein könnte, seiner kranken Mutter Isla (Jodie Comer) zu helfen. Inzwischen sind Ärzte nämlich zu einer echten Seltenheit geworden.
In der zweiten Hälfte des Films widersetzt er sich schließlich dem Willen seines Vaters, der den Arzt für einen unberechenbaren Verrückten hält, und begibt sich gemeinsam mit seiner todkranken Mutter auf eine gefährliche Reise, in der Hoffnung, sie doch noch retten zu können. Schnell wird deutlich, inwiefern der Film an seine Vorgänger anknüpft: nämlich gar nicht – zumindest nicht im Sinne der Handlung. Stattdessen macht der Film eine komplett neue Geschichte auf und ist damit auch ohne Vorwissen sehenswert. Die Welt, in der er spielt, ist jedoch unübersehbar dieselbe, nur hat sie sich um 28 Jahre weiterentwickelt. Und in dieser Zeit hat sich vieles verändert.
Es stellt sich heraus, dass nur Großbritannien dem verhängnisvollen Virus zum Opfer gefallen ist. Dem Rest der Welt ist es offenbar gelungen, die Ausbreitung des Virus weitestgehend einzudämmen. Die britischen Inseln gelten seither als totale Quarantäne-Zone – absolut niemand darf hinein oder hinaus.
Auch die ‘Zombies’ haben sich stark verändert, wobei der Begriff hier eigentlich fehl am Platz ist. Die Infizierten sind keine klassischen, nach Menschenfleisch gierenden, verrotteten und trägen Monster wie in den meisten Zombiefilmen. Und auch keine einfachen tollwütigen Menschen mit blutroten Augen wie in den Vorgängern. Vielmehr wirken sie nun wie Wilde – durch das Virus auf ihre primitivsten Instinkte reduziert, extrem gewalttätig und von einem animalischen Hunger nach Fleisch getrieben. Und zu den Ur-Instinkten gehört scheinbar auch der Drang nach Fortpflanzung. Diese Perspektive stellt für mich eine willkommene und lang ersehnte frische Brise für das ausgelutschte Zombie-Genre dar.
In der Welt gibt es außerdem sogenannte Alphas unter den Infizierten, welche sie wie eine Art Rudelführer befehligen. Was zunächst nach der überzogenen Vision von so manchen fragwürdigen Internet-Gurus klingt, entpuppt sich schnell als furchterregende neue Bedrohung: Während einfache Infizierte sich wie wahnsinnige Höhlenmenschen auf Drogentrip benehmen, ragen die bis zu geschätzt 3 Meter großen, mit Muskeln und Testosteron vollgestopften Alphas am Horizont empor und starren ihren Opfern lauernd und unnachgiebig entgegen. Ihr offenbar überlegener Verstand und der Hang dazu, Köpfe abzureißen, macht sie umso gefährlicher. Wahrlich furchteinflößend. Ich kann nicht umhin, hier eine gewisse Inspiration aus dem Anime Attack on Titan zu erahnen – in welchem groteske, übergroße und sich fremdartig verhaltene Humanoide die Menschheit bedrohen.
Der Film gibt – im Gegensatz zu den meisten Genrevertretern – seiner Handlung wirklich Zeit zum Atmen. Auch wenn die Geschichte an sich nichts Außergewöhnliches behandelt, gelingt es Regisseur Danny Boyle stets, selbst den klischeehaftesten Situationen konsequent aus dem Weg zu gehen. Emotional bedeutsame Momente werden nicht durch plötzliche Zombieangriffe unterbrochen, und Charaktere sterben nicht durch absurde Umstände. Dadurch wirken sie nicht nur authentisch, sondern auch vernünftig – ihre Entscheidungen sind nachvollziehbar, ihre Entwicklung glaubwürdig. Im Großen und Ganzen würde ich den Film sogar eher als eine Coming-of-Age Geschichte beschreiben, nicht als klassischen Zombie-Thriller. Nebenbei thematisiert der Film auf subtile Weise das Konzept der Vergänglichkeit, ohne dabei zu sehr mit vermeintlicher Tiefgründigkeit zu prahlen.
Ein stilistisches Feuerwerk
Schauspielerisch ist der Film solide, doch nicht unbedingt Oscar-verdächtig. Im Grunde konzentriert sich der Film auf nur vier zentrale Figuren. Alfie Williams schafft es erfreulicherweise, die Rolle des jungen Protagonisten so umzusetzen, dass sie nicht ins übermäßig Nervige abrutscht – was bei Kinder-Hauptrollen keineswegs selbstverständlich ist. Auch Aaron Taylor-Johnson und Jodie Comer spielen ihre Rollen makellos, wenn auch nicht herausragend. Mein Favorit ist zweifellos Ralph Fiennes, der in der Rolle des schrulligen Arztes wahrlich aufgeht, mit einer eleganten Balance aus unterhaltsamer Skurrilität und philosophischem Tiefgang.
Auf die nächsthöhere Ebene katapultieren den Film die visuelle Gestaltung und das Sounddesign. Denn das hat es wirklich in sich: Danny Boyle spielt über die gesamte Filmlänge hinweg mit ungewöhnlichen Perspektiven, exzentrischen Kamerafahrten und eindringlichen Effekten. Besonders die Darstellung von Gewaltszenen hat mich beeindruckt: Als Spike zu Beginn seinen ersten Abschuss wagt, wird man regelrecht in seine subjektive Wahrnehmung geworfen. Alles ist unscharf, ruckelt und geht ganz schnell – ein einziger Schockmoment. Ehe man sich versieht, ist das Blutbad bereits angerichtet und man selbst hat kaum etwas davon mitbekommen. Doch je routinierter der junge Spike mit der Zeit Infizierte erlegt, desto ruhiger und nüchterner werden die Szenen inszeniert – eine eindrucksvolle Darstellung seiner persönlichen Entwicklung.
Abseits davon gelingt es dem Film, den Zuschauer Adrenalin und Herzrasen direkt spüren zu lassen. Dramatische oder gar brutale Szenen sind zumeist unscharf und lückenhaft, dafür atmosphärisch, durch schrille Farben und Töne, regelrecht am überlaufen. Fun Fact: Der Film wurde dafür stellenweise mit einem Smartphone gedreht – was den rohen, unmittelbaren Stil echt glaubwürdig macht. Auch sonst gelingt Danny Boyle stilistisch eine Punktlandung. Lange Kamerafahrten, die oft ein bisschen zu lang für das eigene Wohlbefinden sind, und plötzliche, scheinbar zusammenhanglose Einspieler sorgen für echtes Unbehagen.
Es sind stilistische Mittel wie diese, die den Film sowohl atmosphärisch als auch cinematographisch deutlich von gewöhnlichen Zombie-Filmen abheben. Daher empfehle ich den Film sowohl eingefleischten Zombie-Fans als auch gehobeneren Kinogängern. Starke Nerven sollte man jedoch mitbringen. Die letzten drei Minuten des Films verraten, dass eine Fortsetzung bereits in Arbeit ist – wenn auch unter anderer Regie. Für mich steht jedenfalls fest: Danny Boyle hat hier einen wahren Blockbuster geschaffen – eine umwerfende Mischung aus unterhaltsamer Handlung und exzentrischer Darstellung. Und dafür gibt es von mir ganz klar: 9 von 10 Totenschädeln.
Autor: Roman Hucke